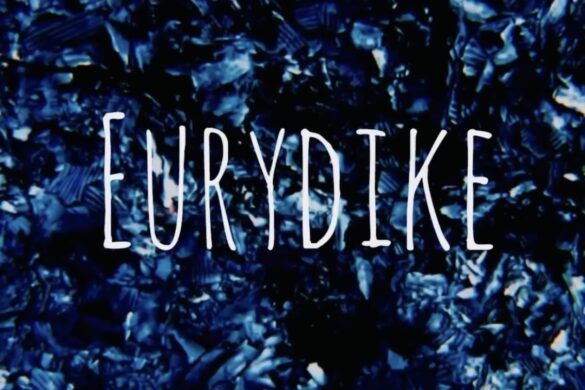der gläubige betritt häufig eine schablone der zweifler häufig einen weg
“Ich zweifle also denke ich. Ich denke also bin ich.“ René Descartes
das schrecklichste was passiert ist ohne sich selbst zu sein, ein gespenst aus fleisch und blut, ist wie ein kleiner tod , darüber hinaus, hinein geworfen werden, in etwas, welches man in gedanken behandelte und schon deshalb nicht dauerhaft leben konnte, dem gewöhnlich alltäglichen. aus dem guckloch eines vermoderten schranks, stickiger geruch nach motten und fäulnis, ohne erkennung seiner selbst, schaut man auf das was war, und unerreichbar in so weiter ferne steht: auf leidenschaft, auf gefühl, und auf sein können, an das man nun höchstens noch glauben kann, neidisch, zerfleischend der blick auf sich selbst, jemand der plötzlich das große unbekannte, jemand dem man nicht länger vertraut …
ich bin kein freund von geschichten, vermutlich weil ich kein geschichtenerzähler bin, und wenn dann denke ich an musil oder constant, also an jemanden bei dem man spürt was stil ist, oder nimm irgendeine prosa von foscolo. das abklopfen von alltäglichkeiten und der belletristischen bewegung eines prosaischen aufbaus, welcher sich sehr häufig nicht dramatisch, also psychologisch aus den handelnden figuren erhebt, eher melodramatisch von außen über die szene der handelnden geworfen wird, ist mir persönlich etwas zu pathetisch , und stellt dazu etwas übertriebenes dar, wenn man ein allerweltsleiden zu einer universellen angelegenheit erklärt, es nicht an der wurzel packt, sondern oberflächlich regelrecht abhandelt, auch dort, wo einige romane mit menschlicher erfahrung und meditation angefüllt zu sein schienen, nur aus roher und trivialer alltagswahrheit bestehen, die beschrieben, nicht dramasiert
worden war, was ein vielfach üblicher fehler ist, bei heutiger erzählender literatur, und in diesem kontext nicht über einen oberflächlichen verismus hinauskommen. bei francois fénelons „die abenteuer des telemach“ ging ich kein risiko einer enttäuschung ein, da ich mich umfangreich mit seinem denken auseinandersetzte. so hatte ich eine prosa welche sehr scharfsinnig um situationen und angelegenheiten zwischen den menschen kreiste und die phänomenologischen tatsachen der menschen, wie ihre motive und intentionen thematisiert und die dahinterliegende strukturelle realität die genau diese phänomene verursacht, sich so einer rationalistisch, konsistenten auflösung widmet, kurzum die metaphysik des situativen (soziologie,phänomenologie, psychologie, kognition) einschließt, dementsprechend handelt dieses buch weniger von griechisch, mythischen details, familiärer und nicht familiärer bindungen und den daraus entstehenden feindschaften, liebschaften, tötungen, verbrüderungen ebenso verwandlungen wie in ovids metamorphosen zu lesen, vielmehr ist es telemachs suche nach seinem vater odysseus, welcher auf dem weg zu ihm durch seine eigenen fähigkeiten, körperlich sowie geistiger natur und das ihnen zugrunde liegende bewusstsein reist, welche man als eine reifeprüfung auffassen kann, dazu die begegnungen mit göttern, weisen, königen, bauern, soldaten und anderen reisenden, auf seinem weg, aus der wunderbare erkenntnisphilosophische implikationen abzuleiten sind, wie nicht anders zu erwarten wenn es sich bei dem erzähler um einen wirklich kultivierten menschen und philosophen handelt. fénelon gelingt es den vorteil, welchen der im mittelpunkt stehende akteur telemach besitzt, nämlich den, das er als einziger weiß wie die geschichte ausgeht, da er von fenelon durch die handlung geleitet und somit seinen denkenden kopf darstellt, auf alle übrigen protagonisten gleichermaßen zu verteilen, so in eine wunderbar ästhetische balance bringt, welche durch die rhetorische rhythmik seiner sprache offenkundig wird. jeder bekommt eine uneingeschränkt starke aufmerksamkeit, im jeweilig gesagten, in denen fénelon der sprache weder lakonisch, noch aufgesetzt romantisch, noch mahnend begegnet, eher ausgewogen umgänglich, jedoch mit philosophischer präzision und ganzheitlichkeit in einer poetisch melodischen erzählweise , so wie es die ästhetik innerhalb der konversation verlangt.
es ist ein unwahrscheinlich verbindendes gefühl wenn man seine eigenen empfindungen ebenso eigenständig gewonnene erkenntnisse bei einem anderen liest, diese momente sind wie eine erleuchtung, nicht ohne euphorische verzückung, und stellt eine der intensivsten philosophischen begegnungen dar, obwohl sie alle tot sind aber was heisst das tot? wir begegnen uns doch, in einer weise die tiefer und inniger nicht sein könnte …zudem die absolutheit jener gewissheit: man ist nicht allein …